Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird flügge: Von der freiwilligen PR-Maßnahme hin zu einer verbindlich prüfbaren Offenlegungspflicht
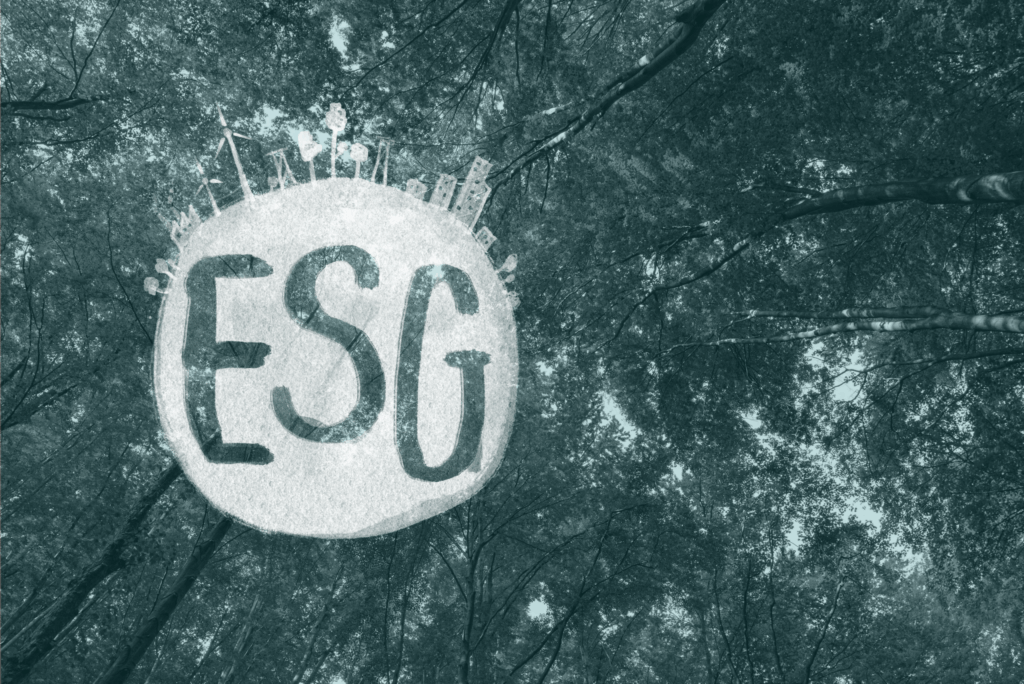
Die 2023 eingeführte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), eine EU-Richtline zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, verpflichtet europäische Unternehmen seit 2025 gemäß den European Sustainability Standards (ESRS) zu berichten. Ziel der CSRD ist es die Qualität, Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern und Unternehmen dazu zu verpflichten, ökologische und soziale Auswirkungen ihres Handelns offenzulegen. Seit ihrer Einführung gab es jedoch auch Kritik hinsichtlich ihrer Umsetzung. Als Reaktion darauf hat die EU-Kommission Ende 2024 mit der sogenannten „Omnibus“-Initiative umfangreiche Entlastungen von den Berichtspflichten angekündigt.
Doch wie hat sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die neuen Vorgaben verändert? Sind Unternehmen transparenter geworden? Gibt es Unterschiede zwischen den Dax40- und den EuroStoxx 50-Unternehmen? Und welche Weiterentwicklungen sind noch erforderlich, um die Umsetzung zu verbessern?
Eine neue Studie des Sustainability Reporting Navigator, einem Teilprojekt des TRR 266 „Accounting for Transparency“, geht genau diesen Fragen nach. Die Forschenden haben die 2024er Nachhaltigkeitsberichte der DAX40- und der EuroStoxx 50-Unternehmen (nach CSRD) analysiert und mit den Berichten von 2023 (nach NFRD) verglichen. Untersucht wurde anhand von ausgewählten Indikatoren in Bezug auf Umfang, Qualität und Transparenzniveau.
Die ersten CSRD-konformen Berichte zeigen deutlich: Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist reifer geworden. Der Fokus verschiebt sich von imagegetriebener Kommunikation hin zu einer strukturierten und faktenbasierten Darstellung. Im Durchschnitt sind die Berichte länger, analytischer und weniger werblich. Doch auch wenn der Fortschritt sichtbar ist, bleibt die Qualität uneinheitlich. Der Weg in Richtung Vergleichbarkeit ist eingeschlagen – aber das Ziel ist noch nicht erreicht.
Die Studie der Forschenden Katharina Hombach (Goethe Universität Frankfurt), Maximilian Müller (Universität zu Köln) und Thorsten Sellhorn (LMU München) liefert sechs zentrale Erkenntnisse:
-
Mehr Umfang, aber große Unterschiede zwischen den Unternehmen
Durch die Einführung der ESRS ist im DAX40 die Informationsmenge deutlich gestiegen: Der durchschnittliche Berichtsumfang wächst gegenüber 2023 um 15 % auf etwa 130 Seiten, der reine Textumfang sogar um 33 %. Gleichzeitig zeigen sich große Unterschiede. Unternehmen, die 2023 eher kurz berichteten, veröffentlichten für 2024 deutlich längere Berichte und verzeichneten so die größten Zuwächse im Berichtsumfang. Einige große Konzerne wie Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Sartorius oder Mercedes-Benz haben für 2024 im Vergleich dazu deutlich kürzere Berichte als im Vorjahr veröffentlicht. Der Grund: Die Berichterstattung wurde von einem eigenständigen Nachhaltigkeitsbericht in den Lagebericht integriert – mit entsprechend schlankerer Form.
-
Auch die Ausgewogenheit und Tiefe der Berichte steigen.
Die zehn ESRS-Standards decken die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ab. Die Forschungsergebnisse zeigen: Unternehmen, die bisher kaum über Nachhaltigkeit berichteten, haben sich deutlich an die neuen Standards angepasst. Die am häufigsten erwähnten Themen nach ESRS: Klimawandel (E1), eigene Mitarbeitende (S1) und Unternehmensführung (G1). Trotz hoher Relevanz in globalen Lieferketten finden soziale Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften (S3) relativ wenig Beachtung in der Berichterstattung. Im Durchschnitt steigt das Informationsangebot für alle zehn ESRS-Standards an – jedoch unterschiedlich stark und von unterschiedlich hohen Ausgangsniveaus.
-
Wesentlichkeit entscheidet – und bleibt eine Black Box.
Ob und wie Unternehmen über ESG-Themen berichten, hängt stark von der sogenannten Wesentlichkeitsanalyse ab, also die individuelle Einschätzung der Unternehmen, welche Themen sie als finanziell bedeutsam oder gesellschaftlich relevant einschätzen. Die neue Art der Berichterstattung führt zwar dazu, dass Berichte insgesamt besser vergleichbar und objektiver werden, z. B. durch den Einsatz quantitativer Schwellenwerte zur Bewertung, wann Sachverhalte als wesentlich einzustufen sind. Doch es bleiben weiterhin Unterschiede bestehen. Die Konsequenz: Selbst innerhalb einer Branche unterscheiden sich die Berichte deutlich, da Unternehmen derselben Branche teils unterschiedliche Themen als wesentlich bewerten. Hier liegt ein Hebel für die anstehenden Omnibus-Reformen: Eine standardisierte Methodik mit verpflichtender Offenlegung würden die Vergleichbarkeit verbessern und das Vertrauen stärken.
-
Auch bei freiwilligen Mehrangaben gibt es Variation.
Viele Unternehmen nutzen die Erleichterungswahlrechte: Angaben, die im ersten Anwendungsjahr (2024) noch nicht verpflichtend sind. Einige Unternehmen stellen diese Daten trotzdem bereit, z. B. Wertschöpfungskettendaten oder Vorjahresvergleiche. Bei anderen Themen wie den erwarteteten finanziellen Auswirkungen von Umweltthemen wird von dem Wahlrecht umfassend Gebrauch gemacht und keine Daten angegegeben. Etwa jedes fünfte Unternehmen lässt (zumindest ausgewählte Kennzahlen) schon mit hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) prüfen.
-
Nachhaltigkeitsberichte gleichen sich Finanzberichten an.
Die 2024er-Berichte verdeutlichen, dass zunehmend standardisierter Begrifflichkeiten und weniger bunter Bilder verwendet werden. Die Berichte sind meist klar entlang der ESRS-Vorgaben strukturiert und enthalten zahlreiche Datentabellen. Statt einer werbenden Marketingbroschüre mit gezielt ausgewählten Informationen zeigt sich nun eher ein Compliance-Dokument: Der Ton wird sachlicher, die Sprache wird standardisierter, technischer und komplexer, die Zielgruppe wird augenscheinlich professioneller. Während frühere Berichte oft einseitig positive Darstellungen enthielten, sind die neuen Reports differenzierter und analytischer. Das ist keine Schwäche, sondern ein Reifeprozess: Nachhaltigkeitsberichterstattung wird transparenter und glaubwürdiger.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung nähert sich damit qualitativ der Finanzberichterstattung an und übersteigt diese im Umfang sogar bei den meisten Unternehmen.
-
Die Berichterstattung der DAX-Unternehmen ähnelt der ihrer europäischen Wettbewerber – mit Ausnahme ausgewählter Gestaltungsspielräume.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung im DAX40 deckt thematisch ähnlich viele Bereiche ab wie die großer europäischer Unternehmen. Im Vergleich fallen jedoch zwei Besonderheiten auf: Zum einen setzen viele DAX-Unternehmen gezielt auf Qualitätssignale. Sie lassen beispielsweise häufiger einzelne Kennzahlen mit reasonable assurance prüfen oder binden detailliertere Informationen entlang der Wertschöpfungskette ein. Zum anderen nutzen sie verstärkt die Gestaltungsspielräume der Berichte. Das verringert zwar den Aufwand bei der erstmaligen Berichterstellung, geht aber zulasten der Transparenz, etwa durch häufigere Querverweise auf andere Dokumente, weniger Vergleichszahlen zum Vorjahr oder zurückhaltende Angaben bei sensiblen Themen. Auch Übergangsregelungen für bestimmte Daten werden häufiger in Anspruch genommen. Auffällig ist zudem, dass Themen wie betroffene Gemeinschaften sowie Verbraucher und Endnutzer im DAX seltener als wesentlich eingestuft werden. Insgesamt zeigt sich ein eher vorsichtiger Umsetzungsstil: Es gibt erkennbare Bemühungen um Qualität, aber die Tiefe ist oft selektiv.
Fazit: Eine große Mehrheit der DAX40-Konzerne wendet ESG-Berichterstattung an – trotz fehlender Umsetzung der CSRD in Deutschland
Trotz der laufenden Omnibus-Debatte, die weitreichende Änderungen der CSRD vorsieht, nutzt die Mehrheit der DAX40-Unternehmen die ESRS in ihrer Berichterstattung. Es ist zu erwarten, dass große, kapitalmarktorientierte Unternehmen auch künftig in diesem Umfang berichten werden und so nicht wesentlich unter das mit den ESRS gesetzte neue Transparenzniveau zurückfallen werden.
Ausblick: Weiterentwicklung notwendig
Eine tragfähige Weiterentwicklung der Berichterstattung erfordert Standards, die konsistente Leitlinien bieten, ohne durch unnötige Komplexität oder vermeidbare Ermessensspielräume an Wirkung zu verlieren. Es braucht verlässliche Prüfmechanismen und eine konsequente Aufsicht, um das Vertrauen in das System zu sichern.
Eine transparentere Wesentlichkeitsanalyse
Die Qualität der ESG-Berichterstattung wird maßgeblich durch die Unternehmen selbst bestimmt. Zentraler Hebel ist dabei die Wesentlichkeitsanalyse, mit der Unternehmen den inhaltlichen Rahmen ihrer Berichterstattung eigenverantwortlich definieren. Entscheidend ist dabei, wie transparent Prozesse offengelegt werden, beispielsweise inwieweit unterschiedliche Stakeholder-Perspektiven berücksichtigt wurden. Ein sorgfältig dokumentiertes, nachvollziehbares Vorgehen im Einklang mit Wortlaut und Geist der ESRS stärkt das Vertrauen, dass auch unbequeme Themen adressiert werden und nicht allein die Außendarstellung im Vordergrund steht. Sind die wesentlichen ESG-Aspekte identifiziert, unterstützen eine klare Struktur sowie (bislang freiwillig) bereitgestellte, maschinenlesbare Datensätze die Auswertung durch Nutzerinnen und Nutzer. Denn bis automatisierte Systeme in der Lage sind, konventionelle PDF-Berichte vollständig und treffsicher zu analysieren, wird es noch dauern.
Insgesamt wird deutlich: Nachhaltigkeitsberichterstattung hat sich vom freiwilligen Kommunikationsinstrument zu einer verbindlichen, prüfbaren Offenlegungspflicht gewandelt. ESG-Informationen müssen genauso sorgfältig, systematisch und nachvollziehbar aufbereitet werden wie Finanzkennzahlen. Unternehmen sollten sich der Tragweite dieses Wandels bewusst sein. Sonst sind sie nicht nur regulatorischen Risiken ausgesetzt, sondern gefährden auch die ihre eigene Glaubwürdigkeit im Verhältnis zu Investoren und anderen zentralen Stakeholdern.
Tiefergehende Analysen und thematische Deep Dives sind in Vorbereitung und werden in den nächsten Wochen unter www.srnav.com veröffentlicht werden.
Zugang zur aktuellen Studie und allen bisher veröffentlichten CSRD-Berichten mit kuratierten Analysen finden Interessierte ebenfalls unter www.srnav.com.
Benchmarking-Hub des Sustainability Reporting Navigator
Update vom 28. Mai 2025:
Die Website des Sustainability Reporting Navigator hat eine neue Funktion eingeführt: den Benchmarking-Hub MySRN. MySRN bietet maßgeschneiderte Einblicke aus der ersten Welle von CSRD-Berichten. Vertreter von über 500 erfassten Unternehmen können auf maßgeschneiderte Benchmarking-Präsentationen und ein interaktives Dashboard zugreifen, um zu untersuchen, wie ihre Nachhaltigkeitsangaben in Bezug auf wichtige Dimensionen wie Länge, Themen und Stimmung im Vergleich abschneiden. Andere Nutzer – darunter Analysten, Wirtschaftsprüfer, Investoren und Forschende – können breitere Trends untersuchen und auf Benchmarking-Präsentationen für Gruppen wie den EURO STOXX 50 und den DAX40 zugreifen.
Dieses Video gibt einen ersten Einblick in die Funktionsweise:
Um es auszuprobieren, besuchen Sie www.srnav.com/auth/register und registrieren Sie sich. Es ist schnell, kostenlos und wurde entwickelt, um das gesamte Berichtswesen zu unterstützen.
Antworten