Wenn der Chef versagt: Wie mittlere Führungskräfte ihre Ziele überdenken, nachdem sie ihre eigenen verfehlt haben
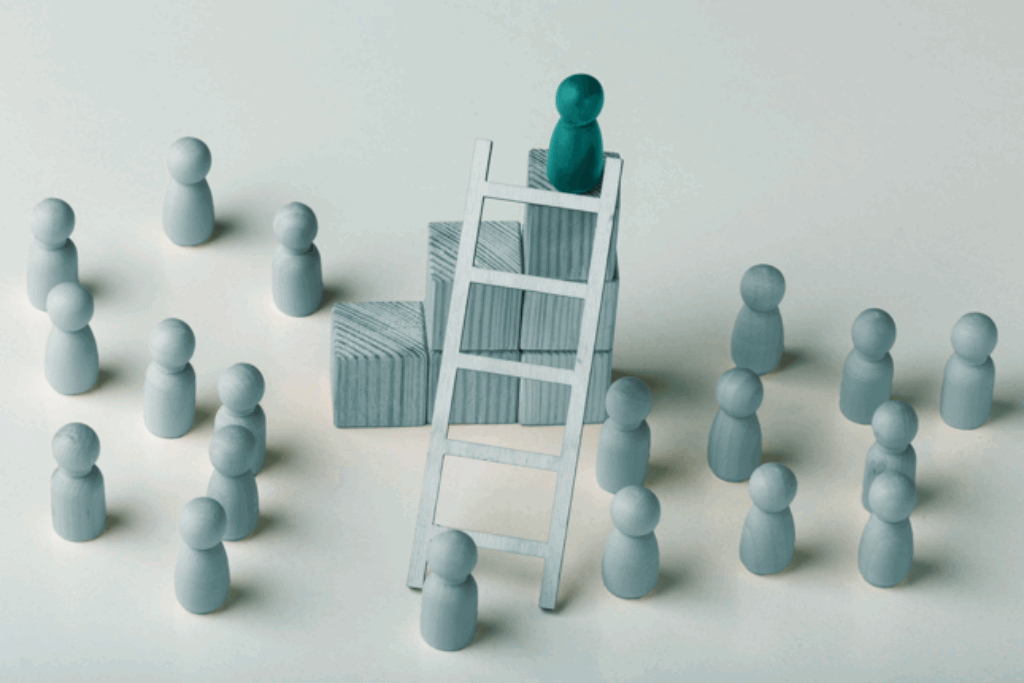
In der heutigen, zunehmend leistungsorientierten Geschäftswelt ist das Setzen von Zielen mehr als nur eine Planungsübung – es ist ein wesentlicher Bestandteil von Motivation, Verantwortlichkeit und Strategie. Eine Studie von Jan Bouwens, Christian Hofmann und Nina Schwaiger „Target Setting in Hierarchies: The Role of Middle Managers” (Zielsetzung in Hierarchien: Die Rolle von mittleren Führungskräften), veröffentlicht im „Journal of Accounting Research“, liefert neue Erkenntnisse darüber, wie Leistungsziele in komplexen Organisationen festgelegt werden. Ihre Untersuchung deckt eine bislang wenig erforschte Dynamik auf: Wie mittlere Führungskräfte ihr Verhalten anpassen, wenn sie zuvor selbst gescheitert sind, insbesondere wenn sie Leistungsziele für ihre Teams festlegen müssen.
Das Problem: Überdenken Vorgesetzte ihre Strategie, wenn sie scheitern?
Die Studie befasst sich mit der Frage aus dem Bereich Management und Organisationsökonomie: Beeinflusst das Nichterreichen von Leistungszielen durch einen mittleren Manager die Festlegung zukünftiger Ziele für seine Mitarbeitenden?
Das Setzen von Zielen ist eine grundlegende Praxis in hierarchischen Organisationen. Manager stützen sich auf eine Mischung aus Daten – historische Leistungen, Benchmarks von Kollegen, Marktbedingungen –, um Ziele festzulegen, die sowohl anspruchsvoll als auch erreichbar sind. Aber was passiert, wenn die Manager selbst hinter den Erwartungen zurückbleiben?
Die Forschenden untersuchen, ob ein solcher Misserfolg die Art und Weise verändert, wie Manager Leistungsinformationen bei der Festlegung neuer Ziele für ihre Teams nutzen. Diese Erkenntnis ist wichtig, da mittlere Führungskräfte eine zentrale Rolle bei der Weitergabe von Zielen aus der obersten Führungsebene und deren Anpassung an die lokalen Gegebenheiten spielen. Wenn ihr eigenes Versagen ihre Strategie verändert, könnte dies Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenshierarchie haben.
Wichtigste Erkenntnis: Manager nutzen vergangene Leistungen stärker, wenn sie ihre eigenen Ziele verfehlen
Bouwens, Hofmann und Schwaiger analysierten Daten aus einer realen dreistufigen Organisation in Deutschland über einen Zeitraum von sechs Jahren (2011–2016). Die Hierarchie umfasste die Zentrale (Auftraggeber), Regionalmanager (Vorgesetzte) und Filialleiter (Agenten). Die Umsatzziele wurden monatlich festgelegt und überprüft, und die mittleren Führungskräfte hatten die Befugnis, diese Ziele auf ihre Filialen zu verteilen.
Die Autoren stellten fest, dass Regionalmanager (Vorgesetzte), die ihre eigenen Ziele nicht erreichten, bei der Festlegung der zukünftigen Ziele stärker auf die bisherigen Leistungen ihrer Filialen zurückgriffen. Im Einzelnen:
- Sie erhöhten die Ziele aggressiver für Filialleiter, die ihre Ziele zuvor übertroffen hatten.
- Umgekehrt senkten sie die Ziele stärker für diejenigen, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren.
- Außerdem reduzierten sie ihre Abhängigkeit von anderen Formen von Kontextinformationen (wie erwarteten Arbeitstagen) zugunsten von harten Daten aus der Vergangenheit.
Diese Verhaltensänderung deutet auf eine strategische Neukalibrierung hin: Manager, die ihre Ziele nicht erreichen, werden risikoscheuer und ziehen es vor, konkrete, beobachtbare Ergebnisse aus der Vergangenheit als Grundlage für zukünftige Entscheidungen heranzuziehen. Sie scheinen einen „Back to Basics”-Ansatz zu verfolgen, in der Hoffnung, ihre eigene Leistung zu verbessern, indem sie dafür sorgen, dass ihre Teams eher erfolgreich sind.
Warum das jetzt wichtig ist: Verantwortlichkeit und Agilität in der Wirtschaft nach der Pandemie
Die Studie ist angesichts der aktuellen globalen Geschäftstrends besonders aktuell:
- Der Leistungsdruck ist höher denn je, da Unternehmen versuchen, sich von den Turbulenzen der COVID-19-Pandemie zu erholen oder ihr Wachstum aufrechtzuerhalten.
- Agiles Management ist zu einem beliebten Mantra geworden, aber effektive Agilität hängt nach wie vor von der Entscheidungsfindung innerhalb von Hierarchien ab.
- Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Zielsetzung und -umsetzung sind zentrale Themen in modernen Governance- und ESG-Berichtsrahmenwerken.
Das Verständnis, wie sich mittlere Führungskräfte nach Misserfolgen anpassen, gibt Aufschluss über die internen Mechanismen der organisationalen Resilienz. Es zeigt, dass Misserfolge nicht nur externe Konsequenzen haben, sondern auch die Art und Weise verändern, wie Führungskräfte führen.
Implications for Stakeholders
- 1. Für Führungskräfte und die Unternehmenszentrale:
Führungskräfte sollten erkennen, dass ihre mittleren Führungskräfte nicht nur Strategievermittler, sondern auch Interpreten sind. Ihre eigenen Leistungsängste beeinflussen, wie sie Unternehmensziele in umsetzbare Vorgaben übersetzen. Schulungs- und Unterstützungsmechanismen könnten Managern helfen, nicht übermäßig auf Misserfolge zu reagieren, und so einen ausgewogeneren Ansatz bei der Zielsetzung gewährleisten. - 2. Für Personalverantwortliche und Organisationsdesigner:
Anreizsysteme müssen die kaskadierenden Auswirkungen von Leistungsdefiziten berücksichtigen. Wenn das Versagen eines Managers zu einer Reihe von leichteren oder schwierigeren Zielen in der nachgelagerten Ebene führt, kann dies die Motivation und die Mitarbeiterbindung beeinträchtigen, insbesondere in angespannten Arbeitsmärkten. - 3. Für politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden:
Aus Sicht der Unternehmensführung unterstreichen die Ergebnisse der Studie die Bedeutung interner Mechanismen zur Rechenschaftspflicht. Bei der Bewertung der organisatorischen Integrität reicht es nicht aus, nur die Endergebnisse zu betrachten – es ist auch wichtig, wie diese Ergebnisse im Laufe der Zeit verfolgt und angepasst werden. - 4. Für Forschende und Strategen:
Diese Studie eröffnet neue Wege für die Untersuchung der Informationsnutzung unter Druck. Sie verbindet Verhaltenskenntnisse mit klassischer Organisationsökonomie und untermauert damit die Vorstellung, dass Entscheidungsfindung in Hierarchien dynamisch und kontextsensitiv ist.
Eine differenzierte Sicht auf Führung in der Praxis
Was in dieser Studie am meisten auffällt, ist das differenzierte Bild, das sie vom mittleren Management zeichnet. Hier werden mittlere Führungskräfte als aktive Akteure betrachtet – als Menschen, deren eigener Leistungsdruck die operative Realität ihrer Untergebenen prägt.
By showing that supervisors who fail become more performance-data-driven in how they set goals, this research reveals a mechanism of behavioral correction within organizations. It suggests that managerial learning isn’t just a formal process—it’s embedded in the target-setting rituals of day-to-day business life.
Fazit
Diese Studie zeigt eindrucksvoll, dass Leistung in Hierarchien nicht nur gemanagt, sondern von den mittleren Führungskräften interpretiert und neu konfiguriert wird. Wenn mittlere Führungskräfte scheitern, versuchen sie nicht einfach, sich mehr anzustrengen, sondern sie versuchen es anders. Für Unternehmen, die anpassungsfähigere und reaktionsschnellere Organisationen aufbauen wollen, ist dies eine wichtige Erkenntnis.
Diesen Blog zitieren: Bouwens, J., Hofmann, C., Schwaiger, N. (2025). Wenn der Chef versagt: Wie mittlere Führungskräfte ihre Ziele überdenken, nachdem sie ihre eigenen verfehlt haben. TRR 266 Accounting for Transparency Blog. https://www.accounting-for-transparency.de/de/wenn-der-chef-versagt-wie-mittlere-fuehrungskraefte-ihre-ziele-ueberdenken-nachdem-sie-ihre-eigenen-verfehlt-haben/
Antworten